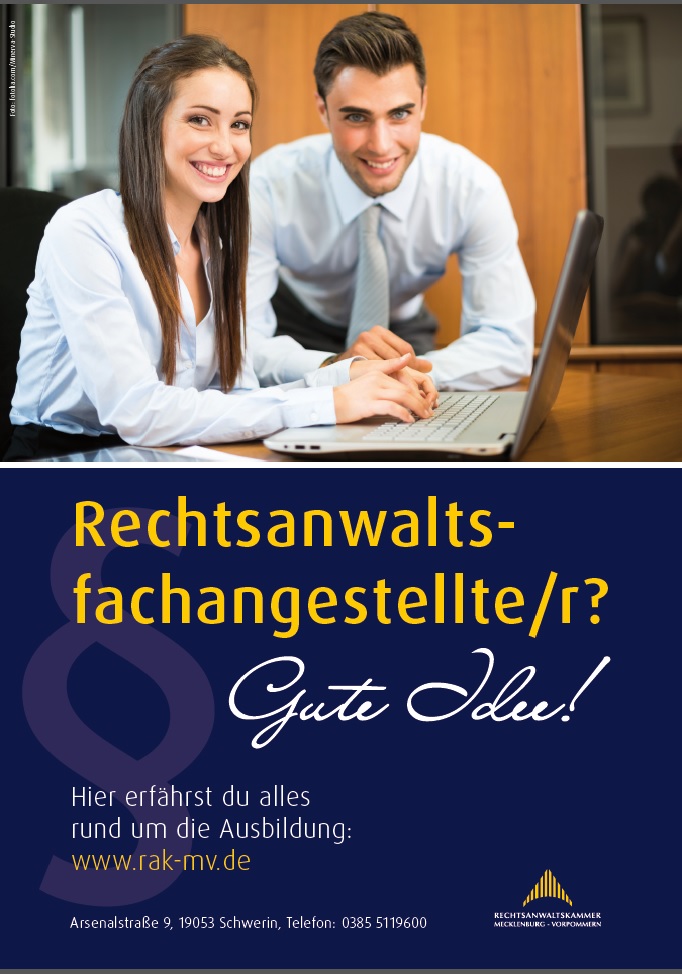Entscheidungen mit Anwaltsbezug
Kein Anspruch auf Löschung negativer Internetbewertung
Der EGMR hat durch Urteil vom 24.11.2015 (AnwBl. 2016, 261, Volltext der Entscheidung AnBl. online 2016, 141) entschieden, dass ein Rechtsanwalt keinen Anspruch auf Löschung eines rufschädigenden Entrags in einem Bewertungsportal hat.
BVerfG: Ablehnung von Beratungshilfe erfordert einzelfallbezogene Begründung
Die nachträgliche Gewährung von Beratungshilfe für die Einlegung und Begründung eines Widerspruchs darf nicht mit dem pauschalen Hinweis darauf abgelehnt werden, dass die antragstellende Person den Widerspruch selbst hätte einlegen können. (BVerfG, Beschl. v. 7.10.2015 - 1 BvR 1962/11).
EGMR: Verurteilung eines Anwalts wegen Beleidigung unzulässiger Eingriff in sein Recht auf freie Meinungsäußerung
In seinem Urteil vom 23. April 2015 in Sachen Morice ./. France (Nr. 29369/10) hat der EGMR entschieden, dass die Verurteilung eines Anwalts wegen Beleidigung einen unzulässigen Eingriff in sein Recht auf freie Meinungsäußerung darstellt, wenn dieser das Verhalten der Untersuchungsrichter, denen mehrere Prozessfehler unterlaufen waren, in einem Zeitungsartikel als parteiisch bezeichnet, Urteil des EGMR (EN) (April 2015).
Anwaltspflichten bei ausschließlich elektronischer Aktenführung
Wird die Handakte eines Rechtsanwalts allein elektronisch geführt, muss sie ihrem Inhalt nach der herkömmlich geführten entsprechen. Sie muss insbesondere zu Rechtsmittelfristen und deren Notierung ebenso wie diese verlässlich Auskunft geben können und darf keine geringere Überprüfungssicherheit bieten als ihr analoges Pendent.
Der Rechtsanwalt, der im Zusammenhang mit einer fristgebundenen Verfahrenshandlung - hier der Einlegung der Beschwerde - mit einer Sache befasst wird, hat dies zum Anlass zu nehmen, die Fristvermerke in der Handakte elektronisch zu überprüfen. Auf welche Weise (herkömmlich oder elektronisch) die Handakte geführt wird, ist hierfür ohne Belang (BGH, Beschluss vom 9.7.2014 - XII ZB 709/13).
Ein Prozessbevollmächtigter darf wegen der Vielzahl der in einer Großstadt im Regelfall vorhandenen Gerichte und Behörden nicht darauf vertrauen, dass ein Dienstleister wie die Deutsche Post AG eine vollständig, schlüssig, aber fehlerhaft postalisch adressierten Brief einer öffentlichen Einrichtung wie dem VG - gegebenenfalls nach vorausgehender Sonderbehandlung - unmittelbar zustellen wird. Eine hierdurch bedingte Verzögerung im Postlauf kann Postdienstleistern in der Regel nicht zugerechnet werden.
Kann die Briefsendung auf Grund fehlender Absenderangaben wegen der dann erforderlichen Absenderermittlung dem Rechtsanwalt nicht zeitnah zurückgesendet werden, gehen dadurch bedingte Zeitverzögerung (hier 15 Tage) auch bei frühzeitiger Einlieferung der Briefsendung zu seinen Lasten (VGH München, Beschluss vom 23.6.2014, 14 ZB 12.2323).
Pflicht des Rechtsanwalts zur eigenverantwortlichen Fristberechnung
LG Frankfurt: Regelung der Auswahl des Mediators in den AGB durch Rechtschutzversicherung ist unwirksam
Mit Urteil vom 07.05.2014 (2-06 O 271/13) hat das Landgericht Frankfurt entschieden, dass eine Klausel in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen einer Rechtsschutzversicherung, wonach der Versicherer für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung nur die Kosten eines von ihm selbst ausgewählten Mediators übernimmt, schon deshalb gegen das Recht den Mediator frei zu wählen (§ 2 Abs. 1 MediationsG) verstößt, weil die Auswahl des Mediators durch den Versicherer erfolge. Gleiches gelte für eine Klausel, die Kostenübernahme für die gerichtliche Interessenwahrnehmung nur gewährt, wenn der Versicherte zuvor ein Streitschlichtungsverfahren mit einem vom Versicherer ausgewählten Mediator durchführt, Urteil vom 07.05.2014 - 2-06 O 271/13.
LG München I: Wirksamkeit von Rentenansprüchen aus Sozietätsverträgen
Mit Urteil vom 04.03.2013 (15 O 8167/12 - NJW 2014, S. 434 ff.) hat das Landgericht München I entschieden, dass eine Klausel in einem Sozietätsvertrag, wonach jüngere Sozien, die durch Kündigung aus der Sozietät ausgeschieden sind, unbeschränkt und ohne Ausgleich persönlich für die Rentenansprüche älterer Sozien haften, nach § 723 Abs. 3 BGB zwingend unwirksam ist.
BGH: Kein Formularzwang in der Zwangsvollstreckung
Mit Beschluss vom 13.02.2014 (VII ZB 39/13) hat der BGH entschieden, dass bei Anträgen auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses der Gläubiger vom Formularzwang entbunden ist, soweit das Formular unvollständig, unzutreffend, fehlerhaft oder missverständlich ist. Es sei auch nicht zu beanstanden, wenn in dem Formular Streichungen und Berichtigungen vorgenommen werden sowie auf Anlagen verwiesen wird. Auch die Verwendung eines geringfügig im Layout abweichenden Formulars sei zulässig.
BGH: Pflicht zur Löschung der vor Mandatsannahme abgehörten Telefonate zwischen Verteidiger und Beschuldigten
Mit Beschluss vom 18.02.2014 (StB 8/13) hat der BGH entschieden, dass ein zwischen Verteidiger und Beschuldigten abgehörtes Telefonat auch dann gelöscht werden müsse, wenn es lediglich der Anbahnung eines Mandatsverhältnisses gedient habe.
BGH zum Zeugnisverweigerungsrecht vor Mandatsanbahnung
Das berufsbezogene Vertrauensverhältnis, das zu schützen § 53 StPO beabsichtigt, beginnt nicht erst mit dem Abschluss des zivilrechtlichen Geschäftsbesorgungsvertrages, sondern umfasst auch das entsprechende Anbahnungsverhältnis. Entsprechende automatisch aufgezeichnete Telefongespräche zwischen Strafverteidiger und potentiellem Mandanten sind daher unverzüglich zu löschen. (BGH, Beschl. v. 18.02.2014 - StB 8/13).
BGH: Zeitpunkt der Verjährungshemmung bei schwebenden Verhandlungen
Bei schwebenden Verhandlungen wirkt die Hemmung grundsätzlich auf den Zeitpunkt zurück, in dem der Gläubiger seinen Anspruch gegenüber dem Schuldner geltend gemacht hat. (Anschluss an BGH, Urteil vom 11.11.1958 - VI ZR 231/57; v. 13.02.1962 - VI ZR 195/61) Leitsatzentscheidung des BGH, Beschluss vom 19.12.2013 - IX ZR 120/11.
BGH: Richtigkeitskontrolle der Faxempfangsnummer als anwaltliche Organisationspflicht
Missbrauch des Anwaltstitels durch ehemaligen Rechtsanwalt
Verstößt ein ehemaliger Rechtsanwalt wiederholt gegen die Vorschrift des § 132a StGB, durch gerichtliche Schriftsätze, Erteilung von Gebührenrechnungen etc., kann die Strafe von zwei Jahren dennoch zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn der Verurteilte mittlerweile Rentner ist (AG Berg. Gladbach, Urt. v. 12.11.2013, 43 Js 11/13).
Abratepflicht des Anwalts trotz Deckungszusage
Hat die Rechtsschutzversicherung eine Deckungszusage für einen Prozess erteilt, ohne dass die Deckungszusage etwa durch falsche Angaben erlangt worden ist, greift der Anscheinsbeweis zu Gunsten des den Rechtsanwalt in Regress nehmenden Mandanten, bei vollständiger Risikobelehrung den Prozess nicht geführt zu haben, nicht ein. Denn auch für einen vernünftig handelnden Mandanten würde bei Vorliegen einer Deckungszusage der Rechtsschutzverischerung das Wagnis einer nur geringen oder wenig erfolgversprechenden Prozessführung als eine solche Chance erschienen, dass er sie ergreift. Dies gilt gerade dann, wenn im Zeitpunkt der Klageerhebung eine maßgebliche höchstrichterliche Entscheidung noch nicht ausgegangen war (hier: Schönheitsreparaturklausel "ausführen zu lassen") und auch der Rechtsanwalt des Mieters eine im Streitkomplex einschlägige mieterschützende Regelung (zur Kündigungsfrist) übersieht. (KG, Urteil vom 23.09.2013 - 8 U 173/12).